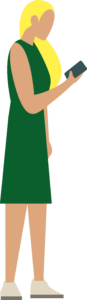Die Linguistik geht davon aus, dass Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit eng miteinander verknüpft sind. Für uns gewinnt Realität, was wir auch sprachlich benennen. Und deshalb ist eine geschlechtergerechte Sprache wichtig.
Gendergerechte oder auch geschlechtergerechte Sprache meint eine Sprache, die immer beide – respektive alle – Geschlechter ausdrücklich anspricht. Sie ist also ein Inklusions-Verfahren auf Ebene der Sprache. Im Deutschen wird oft das sogenannte generische Maskulinum benutzt. Der Begriff bringt zum Ausdruck, dass in der männlichen Form die weibliche mitgemeint sei. Wenn ich also sage oder schreibe: „Die Mitarbeiter der Firma X…“ geht diese Sprachverwendung davon aus, dass sich Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitende, die sich keinem Geschlecht zuordnen, durch diese Anrede angesprochen fühlen. Viele Forschungen zeigen, dass dies aber nicht der Fall ist. Menschen müssen, wenn sie sich angesprochen fühlen sollen, auch explizit genannt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun: über die Partizipialform „Mitarbeitende“ oder über Formen, die mehr als zwei Geschlechter ausdrücken, wie Mitarbeiter/innen oder Mitarbeiter*innen.
Will also ein Unternehmen alle Mitarbeitenden gleichermassen ansprechen, kommt einer geschlechtergerechten Sprache eine grosse Bedeutung zu. Jüngste Forschung zeigt, dass Frauen* unabhängig von ihren Fähigkeiten im Beruf nach wie vor mit grösseren Hürden zu kämpfen haben als Männer. Und nicht nur Frauen*, sondern auch andere Gruppen werden aufgrund von Geschlecht diskriminiert. So sind Transmenschen in der Arbeitswelt heute sehr grossen Diskriminierungen ausgesetzt. Und auch die sexuelle Orientierung kann nach wie vor zu Ausschlüssen führen. Da die deutsche Sprache das Geschlecht grammatikalisch sehr oft explizit macht, ist die Kategorie Geschlecht in vielen Aussagen in irgendeiner Form präsent. Dabei funktioniert die Sprache binär – das heisst, es gibt im Hinblick auf das menschliche Geschlecht nur männlich oder weiblich. So besteht eine inkludierende Sprache in einem ersten Schritt darin, diese beiden Positionen zu berücksichtigen und gleichwertig zu behandeln.
Viele sind der Ansicht, dass das Problem der Exklusion, also das Problem, sich durch die männliche Form nicht angesprochen zu fühlen, Frauen* selbst zuzuschreiben sei. Diese Ansicht ignoriert wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Sprache auch innere Bilder schafft. Wird immer nur von „der Chef“ und „der Arzt“ gesprochen, so sind die inneren Bilder, die entstehen, männlich – nicht weiblich. Und wenn Frauen* auf dieser Ebene nicht vorkommen, dann ist es viel schwieriger für sie, eine Vision davon zu entwerfen, einmal selber „der Chef“ oder „der Arzt“ zu sein.
Die eigene Sprache so belassen zu wollen, wie sie ist, hat aber auch damit zu tun, dass sie gar nicht so leicht zu verändern ist. Es braucht also zuerst einmal ein Problembewusstsein und dann den Willen, die eigene Sprache inkludierender zu gestalten.
Mit der Berücksichtigung von Mann und Frau auf Ebene der Sprache kommen wir einer gendergerechten Sprache zwar schon näher. Der Geschlechterdualismus bildet aber noch nicht alle Existenzweisen von Geschlecht ab. Das deutsche Verfassungsgericht hat ein drittes Geschlecht anerkannt, das alle Menschen umfasst, die in diesem Geschlechterdualismus nicht enthalten sind. Also Menschen, die sich, wenn auch in unterschiedlicher Weise, „zwischen“ den Geschlechtern finden wie Transmenschen, Intersex-Menschen, oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Ich vertrete die Ansicht, dass unsere Gesellschaft sprachlich inkludierend mit allen Existenzweisen von Geschlecht umgehen und diese dritte Geschlechterposition anerkennen sollte. Historisch gesehen ist diese Haltung aber noch viel umstrittener, als die Anerkennung einer Chancengleichheit von Mann und Frau. Durch die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache, die Frauen explizit anspricht, ist schon ein grosser und wichtiger Schritt gemacht! Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir eines Tages auch weitere Existenzweisen offiziell anerkennen. Dass wir also auch sprachliche Lösungen finden für Menschen „zwischen den Geschlechtern“. Neben Formulierungen, die eine geschlechtliche Zuordnung vermeiden (Mitarbeitende, Führungskraft), kann hier der Gender Gap oder Unterstrich (Mitarbeiter_innen) oder das „Sternchen“ oder Asterisk (Chef*innen) verwendet werden.
Es gibt kritische Stimmen, die beklagen, dass solche Lösungen formal unschön seien und die Sprache schwerfällig machten. Es stimmt, dass wir in der Sprachverwendung in der Regel sparsam sind und uns kurz und prägnant auszudrücken wollen. So ist eine flüssige Ausdrucksweise wichtig. Mündlich ist es jedoch ziemlich einfach, diese Zeichen durch eine kurze Pause im Redefluss auszudrücken. So scheinen mir die Hürden mehr in Sprach- und Denkgewohnheiten zu liegen, als in Sprachökonomie und -ästhetik. Klar müssen wir uns erst an diese Formen gewöhnen und erscheinen sie bei erster Verwendung „holperig“. Und vielleicht werden sie sich in nächster Zeit auch noch verändern. Sprachverwendung ist aber immer auch Sprachenpolitik. Wenn sich eine Gesellschaft dafür entscheidet, mit einem dritten Geschlecht inkludierend umzugehen, wie dies Deutschland gerade getan hat, so wird sie auch sprachliche Formen finden müssen, um dieser Inklusion Ausdruck zu verleihen.
Über die Autorin / den Autor

Dr. Christa Binswanger ist Ständige Dozentin für Gender und Diversity an der Universität St.Gallen.
Relevante Weiterbildung
Newsletter
Die neusten Beiträge direkt ins Postfach.
Beitrag teilen
Weitere Beiträge
Future of Work und die Rolle von Diversity, Equity & Inclusion
Leadership im Umbruch: Fünf Trends einer modernen Führung
Ist die Zukunft der Arbeit auch für den Rechtsmarkt relevant?
Warum inklusive Führung für alle Generationen wichtig ist
Brauchen junge Jurist:innen auch Leadership? Einteilung nach Generationen – etwas willkürlich, aber nützlich